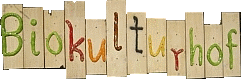Palaver 20 Wirklichkeit
Zu Konzept und Ablauf der Veranstaltung s. Palaver 19
Scheint im ersten Moment ein abgehobenes Thema, aber mit den Palavern versuchen wir ja im Wesentlichen, erkundend unterwegs zu sein, Wirklichkeit möglichst vielfältig und aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, unsinnige Aussagen auszusortieren, aber andererseits nicht vorschnell zu Antworten zu kommen, wo erst mal Fragen angesagt wären.
Es sollte also so eine Art Konsens darüber geben, dass Wirklichkeit nicht beliebig ist und Aussagen wahr oder falsch, vernünftig oder unvernünftig sein können, sonst kann man sich das diskutieren sparen oder es ist nur eine Bühne, um schlau daherzureden.
Es geht ja auch darum durch einen an Wirklichkeit orientierten Weltumgang Boden unter die Füße zu bekommen.
Oft versuchen wir uns durch Nachfragen zu vergewissern. Ein Regenbogen. Ein Unfall. Wirklich? Wenn wir Glück haben, können wir in der realen Welt nachschauen. Aber fast alle Informationen über die Welt sind heute aus zweiter Hand: Medien, Internet.
Jedes Bild, das wir uns von der Welt machen, hat Konsequenzen für uns. Da liegt mein Schwerpunkt. Nicht eine Sicht zu beweisen. Das ist in der Regel sowieso nicht möglich. Auch Begriffe, die wir gewöhnlich verwenden, wie Ich oder Selbst, Seele zumal, sind philosophisch Konstruktionen und nicht eindeutig greifbar. Sondern ich will aufzeigen oder zumindest darauf hinweisen, dass jede Sicht auch eine Funktion erfüllt oder einem Bedürfnis entspringt: nach Vereinfachung, nach Eindeutigkeit, nach Orientierung, nach Zugehörigkeit, nach narzisstischer Bestätigung usw., und entsprechend Folgen hat für unser Sein in der Welt. Glauben wir an die Unsterblichkeit der Seele oder ein Leben nach dem Tode, wird evtl. das Leben vor dem Tod weniger wichtig oder besser ertragbar, so zumindest der Wunsch.
Fangen wir mit Ich oder Bewusstsein an. Das steht unzweifelhaft in unserer Kultur an erster Stelle. Nicht erst seit Descartes: „Ich denke, also bin ich“. Schon die platonische Idee hat zum Inhalt, den Körper mit seinen naturhaften Unwägbarkeiten in den Griff zu bekommen. Es zählt die reine Vernunft, abgetrennt von allem Übrigen. Das wiederum bringt uns in die Nähe des Göttlichen. Heute auch in die Nähe des Transhumanismus.
Das prägt bis heute unseren Umgang mit uns und der Welt. Unser Körper soll funktionieren, damit wir uns selbst optimieren können. Wenn nicht, muss er repariert werden. Entsprechend dieser Denkweise haben wir z.B. eine Eingreifmedizin, die tätig wird, wenn Krankheit oder auch nur Abweichung vom Standard vorliegt.
Auch der übrigen Natur stehen wir abgetrennt gegenüber und sie ist im wesentlichen Ressource und es muss höchstens beachtet werden, dass diese durch entsprechenden Schutz nicht knapp wird.
Letztlich ist diese Trennung in ein Innen, dessen ich mir sicher bin, und ein Übriges außen, mit dem ich irgendwie umgehe, aber eine rein philosophische Konstruktion und es gab Zeiten und Kulturen, wo diese Trennung nicht selbstverständlich war.
Heute geht das ja sogar so weit, dass die Frage aufkommt, ob dieses außen, die Welt, überhaupt existiert, weil ich ja alles erst über Sinne wahrnehmen muss und ohne Zweifel zumindest mit einem subjektiven Anteil die Welt mir konstruiere, auch je nach bisherigen Erfahrungen.
In einem radikalen Konstruktivismus zählt nur noch das Subjektive. Mit gewissen Einschränkungen, weil zumindest Vorhersagbarkeit weiter gelten soll.
Dass die Welt nur Schein ist, lässt sich aber auch nicht beweisen, denn, wenn wir uns alles konstruieren, ist nichts wahr oder solide Grundlage, also auch der Schein nicht. Ein Selbstanwendungsproblem. Letztlich ändert sich gar nichts, egal wie wir die Welt sehen. Ich kann mir immer noch an der gleichen Stelle den Kopf anstoßen
Um plausibel zu machen, dass die Welt Schein sein könnte, werden zudem oft Beispiele herangezogen, die erstaunlich schlicht und leicht widerlegbar sind. Etwa optische Täuschungen. Wir schätzen etwas falsch ein, etwa die Größe von Gegenständen, was in Wirklichkeit jedoch die gleiche Größe hat, wenn wir messen. Also können wir letztlich ja doch feststellen, was wirklich ist.
Das legt nur nahe, nicht bei einer subjektiven Sicht zu bleiben, sondern aus verschiedenen Blickwinkeln zu schauen, um der Wirklichkeit näher zu kommen.
Wenn jemand glaubt, die Welt nicht objektiv erkennen zu können, müsste das ja zu einer gewissen Demut führen. In unserer Kultur ist paradoxerweise jedoch oft das Gegenteil der Fall. Das Subjektive und also Individuelle allein zählt und wird so überhöht. Eine an der Wirklichkeit orientierte Kritik daran kann es ja nicht mehr geben.
Also hat man freie Bahn. Im Alltag wird so vernünftige Argumentation und gemeinsames aushandeln von Wahrheit überflüssig. Anekdotische Wahrheiten lassen sich selbstbewusst vertreten: nach dem Muster: ich habe bei Vollmond gesät und dann hatte ich eine gute Ernte, also war der Vollmond die Ursache. Als ob es keine anderen Ursachen gäbe. Dummheit (bei Orwell heißt es: Unwissenheit) ist Stärke. Oft werden uns Korrelationen als Ursache/Wirkung verkauft, was aber selten schlüssig ist. Herzinfarkte und die Anzahl der Ärzte kommen in Städten verstärkt vor, aber nicht die Ärztedicht ist Ursache für Herzinfarkte, sondern als Drittes wahrscheinlich die allgemeinen Lebensbedingungen in der Stadt mit Stress und der Möglichkeit Geld zu verdienen.
Unsinnige Aussagen lassen sich also allemal aussortieren, auch wenn es mit dem Wahrheitsbegriff auf manchen Gebieten nicht so einfach ist. In der Physik ist es anders als in der Psychotherapie. Bei Wertungen ist Naturwissenschaft draußen und wahr und falsch eher philosophischen Betrachtungen zugänglich.
Wenn alles eh konstruiert ist, kann auch beliebig jede Art von Normalität oder Wirklichkeit dekonstruiert und neu konstruiert werden. Das lässt sich dann auch gerne mit Macht durchsetzen, weil objektive Kritik eben nicht möglich ist. Eine Spielwiese für alle, die eh nur im Kopf zuhause sind und aus narzisstischer Not heraus handeln. Aufgehoben und zugehörig können wir uns dann nur fühlen, wenn wir uns mit anderen zusammentun, die die gleiche Meinung, die gleiche Ideologie oder den gleichen Glauben haben.
Auf der Grundlage der Beliebigkeit lässt sich z.B. auch jede Art von Gläubigkeit und Esoterik gut absichern.
Aber auch in der Identitätspolitik gibt es dazu zahlreiche fragwürdige Konstruktionen:
Nur wer etwas selbst erlebt hat oder zu einer bestimmten Gruppe dazugehört, darf sich zum Thema äußern. Eine allgemeine Diskussion kann es gar nicht mehr geben. Vernünftige Argumente nicht direkt betroffener braucht es nicht mehr.
Nur wer dunkelhäutig ist, kann eine entsprechende Rolle in einem Film haben.
Wer sich im falschen Körper gefangen fühlt, kann auch als Kind schon das Geschlecht wechseln. Beratung oder Abwägung ist nicht angesagt. Natur hat keine Bedeutung.
Um der mit der Ich-Überhöhung einhergehende Naturentfremdung und auch einer Selbstentfremdung zu entgehen, lohnt ein Blick auf die Leibphilosophie.
Grundlage ist hier der gespürte Leib: Ich spüre mich, also bin ich. Hier geht es um die Natur,
die wir selbst sind. Wir spüren uns, wenn wir Hunger oder Durst haben, uns bewegen, körperlich arbeiten, Freude oder Schmerz empfinden, wütend sind oder traurig, Angst haben oder Scham empfinden usw.
Alles von Bedeutung und wirklich, aber keiner messenden Naturwissenschaft zugänglich.
Im Leib sind zudem unsere Lebenserfahrungen gespeichert. So kann der Körper eine Quelle von wertvollen Hinweisen für die Lebensgestaltung sein, wenn wir denn darauf achten.
Bei diesem Ansatz stehen wir nicht mehr der Natur beherrschend oder wohlwollend gegenüber wie bei der heute vorherrschenden Anschauung, sondern sind uns selbst erst einmal als Natur gegeben.
Der Leib hat so etwas wie eine absolute Identität. Wir zweifeln nicht. Im Gegensatz zum abstrakten Ich, wo wir uns manchmal fragen, wer wir eigentlich sind, weil wir ja auch so oder so sein könnten. Ich denke (zu viel), also verliere ich mich, in allen möglichen Kopfkonstruktionen und den vielen Wahlmöglichkeiten.
Bei der Leibphilosophie geht es darum, anzunehmen, was die Natur vorgibt. Nicht zu verdrängen oder zu beherrschen, was wir spüren und was bisweilen unangenehm sein kann, sondern alles anzunehmen und es zu kultivieren. Das dürfte uns näher an die Wirklichkeit heranbringen.
An dieser Stelle wieder: Biokultur.
Dem Ich kommt zwar weiterhin eine hilfreiche, aber durchaus untergeordnete Rolle zu. Es ist keine eigenständig greifbare Instanz mehr, die einen Körper nur als Gebrauchsgegenstand hat.
Bewusstsein wird verstanden als etwas, was sich aus Materie als höchste Stufe ergeben hat, mit Ansätzen im Tierreich, also nicht mehr dem Menschen einzigartig.
Das ist wie ein Wunder und über alle Maßen bestaunenswert. Und allemal keine schlichte mechanistische Naturauffassung. Der Zauber ist hier wieder in der Welt selbst und nicht in einer Überwelt oder Zweitwelt. Materie ist von Anfang an nicht tot und die Selbstorganisation bietet unendlich viele Möglichkeiten, auch wenn es uns schwerfällt, uns das vorzustellen. Weil wir zu sehr mit unseren mechanischen Konstrukten vergleichen, die nur existieren, weil und solange wir sie erhalten.
Das lässt uns leicht in Analogie schließen, auch beim Leben müsse eine vis vitalis, eine Lebenskraft von außen dazu kommen, z.B. durch einen Gott. Was aber das Problem ja erst mal nur verschiebt.
Leben lebt aus sich heraus.
Wir können uns als Teil in einer faszinierenden Natur aufgehoben und verbunden fühlen und so näher an der Wirklichkeit, statt in unseren Eigenkonstruktionen. In einer Natur, die nicht nur gut ist oder heilig, in der Krankheiten dazugehören, sich aber auch Widerstandskräfte entwickeln, auf die wir vertrauen können. Und der Tod gehört auch dazu.